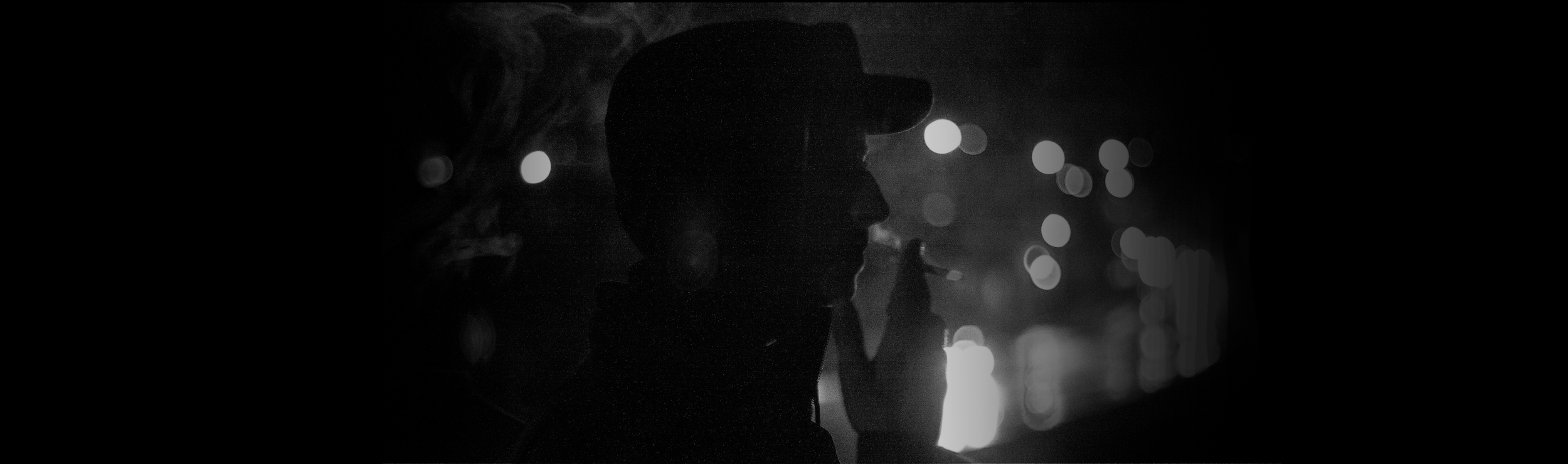
Jugendstrafrecht
Das Jugendstrafrecht ist ein spezielles Straf- und Strafverfahrensrecht für Jugendliche, die zur Tatzeit mindestens 14, aber noch nicht 18 Jahre alt sind. Es ist im Jugendgerichtsgesetz (JGG) geregelt. Sein Kerngedanke ist „Erziehung vor Strafe“. Es verfolgt in erster Linie das Ziel, durch flexible und altersangemessene Maßnahmen einer erneuten Straffälligkeit der betroffenen Jugendlichen entgegenzuwirken. Nicht die Tat, sondern die umfassend gewürdigte Persönlichkeit des Täters steht im Vordergrund.
Warum gibt es ein eigenes Jugendstrafrecht?
Jugendliche besitzen in der Regel noch nicht die gleiche Verantwortungsreife wie Erwachsene: Ihre Fähigkeit, das Unrecht der Tat zu erkennen und sich entsprechend zu verhalten, ist weniger ausgeprägt. Deshalb kann ihnen bei Straftaten nicht der gleiche Schuldvorwurf gemacht werden wie einem Erwachsenen. Hinzu kommt eine im Vergleich zu Erwachsenen deutlich größere Formbarkeit: Charakter- und Persönlichkeitsbildung sind noch nicht abgeschlossen, sondern befinden sich in ständiger Entwicklung; die Chancen, Einstellungen und Verhalten von Jugendlichen durch geeignete erzieherische Maßnahmen nachhaltig zum Positiven zu beeinflussen, sind wesentlich größer als bei Erwachsenen.
Diese beiden Aspekte rechtfertigen ein eigenes Jugendstrafrecht, in dem nicht Sühne, Vergeltung, Abschreckung oder Sicherung der Allgemeinheit, sondern Erziehung, Sozialisation und Resozialisierung Art und Maß der Reaktion auf die Straftat bestimmen. („Erziehungsgedanke des Jugendstrafrechts“).
Wird ein Strafverfahren gegen Jugendliche geführt, so ist auch bei der Ausgestaltung des Verfahrens auf ihr jugendliches Alter und ihren Entwicklungsstand Rücksicht zu nehmen. Denn Jugendliche haben in der Regel größere Schwierigkeiten als Erwachsene, das Verfahren zu verstehen, ihren Standpunkt darzulegen und sich gegen den Tatvorwurf wirksam zu verteidigen. Dementsprechend wird auch das allgemeine Strafverfahrensrecht durch das JGG in vielen Punkten modifiziert.
Für wen gilt das Jugendstrafrecht?
Das Jugendstrafrecht ist uneingeschränkt anwendbar für Jugendliche, d. h. für Menschen, die zur Tatzeit im Alter von 14 bis 17 Jahren waren.
Auf Heranwachsende (18- bis 20-Jährige) sind zentrale Normen (aber nicht alle) des Jugendstrafrechts nach Maßgabe der §§ 105 ff. JGG anzuwenden. Hierbei wird insbesondere geprüft, ob der Heranwachsende von seinem Reifezustand zur Tatzeit im Hinblick auf die konkrete Tat noch einem Jugendlichen gleichzustellen war oder ob er jedenfalls eine jugendtypische Tat (z. B. Ladendiebstahl als Mutprobe, Schlägereien oder Beleidigungen aus Imponiergehabe) begangen hat. Wenn jedoch keine dieser beiden Voraussetzungen erfüllt ist, werden auch Heranwachsende nach dem allgemeinen, für Erwachsene geltenden Strafrecht bestraft.
In der Praxis wird sehr häufig auch bei Heranwachsenden noch das Jugendstrafrecht angewendet. Dies gilt besonders bei schweren Straftaten, so dass beispielsweise in der Gruppe der wegen schwerer Gewaltdelikte verurteilten Heranwachsenden die Verurteilung nach Jugendstrafrecht die Normalität darstellt (über 90 Prozent). Die Anwendung von Jugendstrafrecht oder Erwachsenenstrafrecht auf Heranwachsende wird allerdings in den einzelnen Ländern unterschiedlich gehandhabt.
Welche Maßnahmen kann das Jugendgericht verhängen?
Das Jugendstrafrecht knüpft zwar an die Straftatbestände des allgemeinen Strafrechts im Strafgesetzbuch (StGB) an. Die dort vorgesehenen Strafrahmen (z. B. Mindest- oder Höchstmaß einer für bestimmte Straftaten angedrohten Freiheitsstrafe, Möglichkeit einer Geldstrafe) und die im Einzelfall anzuwendenden Regeln der Strafzumessung (z. B. die objektiven Umstände der Tat, das Vorliegen eines Geständnisses, bestehende Vorstrafen) werden jedoch durch eigenständige Regelungen zu den jugendstrafrechtlichen Rechtsfolgen ersetzt. So stellt das JGG weitaus vielfältigere Reaktions- und Sanktionsmöglichkeiten zur Verfügung als das Erwachsenenstrafrecht, das sich im Wesentlichen auf Geld- und Freiheitsstrafen beschränkt. Dies ermöglicht es dem Jugendrichter, im jedem Einzelfall die für den Täter geeignetste Maßnahme zur Vermeidung künftiger Straffälligkeit und zur Wiedereingliederung zu finden.
Gemäß § 5 JGG unterscheidet das Gesetz drei Arten von Reaktionen:
Erziehungsmaßregeln
Zuchtmittel
Jugendstrafe
Dabei richtet sich die Wahl der Rechtsfolge danach, welche nach der Persönlichkeit des Täters den besten Erfolg für seine Resozialisierung verspricht. Versprechen mehrere Maßregeln den gleichen Erfolg, ist diejenige zu wählen, die den geringsten Eingriff darstellt. Vergleichsweise oft wird gegen Jugendliche die Ableistung von unentgeltlichen Arbeitsstunden, beispielsweise in gemeinnützigen Einrichtungen, verhängt. Dies kann gerade Jugendlichen, die die Schule oder eine Lehre abgebrochen haben, helfen, mehr Struktur in den Alltag zu bringen. Ein Jugendlicher oder Heranwachsender, der bereits ein festes Arbeitseinkommen hat, kann beispielsweise zu einer – zumindest teilweisen – finanziellen Schadenswiedergutmachung verurteilt werden. Die Verhängung von Arrest kommt dagegen vor allem bei Tätern in Betracht, die nicht zum ersten Mal in Erscheinung treten, bei denen aber noch keine schädlichen Neigungen, wie sie für die Verhängung von Jugendstrafe Voraussetzung sind, festgestellt werden. Um eine optimale Einwirkung auf den Täter zu erreichen, sind mehrere Maßnahmen auch miteinander kombinierbar.
Besonderheiten im Jugendstrafverfahren
Das Jugendstrafverfahren unterliegt eigenen Regeln. Zuständig sind spezielle Jugendgerichte. Die dort eingesetzten Jugendrichterinnen und Jugendrichter sowie Jugendstaatsanwältinnen und Jugendstaatsanwälte sollen in der Lage sein, dem Alter und Entwicklungstand sowie der erzieherischen Zielsetzung angemessen mit den jungen Personen umzugehen. Sie sollen zudem über besondere Kenntnisse beispielsweise in Kriminologie, Pädagogik und Jugendpsychologie verfügen. Weitere Besonderheiten des Jugendstrafverfahrens sind etwa die grundsätzlich vorgesehene Beteiligung der Jugendgerichtshilfe (wahrgenommen von den Trägern der Kinder- und Jugendhilfe und geregelt insbesondere in § 38 JGG und § 52 des Sozialgesetzbuchs VIII), Erweiterungen der notwendigen Verteidigung („Pflichtverteidigung), umfassendere Belehrungs- und Informationspflichten, Nichtöffentlichkeit der jugendgerichtlichen Hauptverhandlung sowie erweiterte Möglichkeiten einer informellen Verfahrenserledigung („Diversion“).
All diese Besonderheiten sorgen dafür, dass Jugendliche und Heranwachsende im Strafverfahren altersgerecht behandelt und gefördert werden – mit dem Ziel, sie dauerhaft von weiteren Straftaten abzuhalten und ihre soziale Wiedereingliederung zu ermöglichen.
Sie benötigen einen Anwalt für Jugendstrafrecht: die Strafrechtskanzlei Clausen steht Ihnen zur Seite
Während es im Erwachsenenstrafrecht vorrangig um Schuldausgleich und „gerechte Bestrafung“ geht, verfolgt das Jugendstrafrecht primär ein anderes Ziel. Durch flexible und altersangemessene Maßnahmen soll einer erneuten Straffälligkeit der betroffenen Jugendlichen entgegengewirkt werden. Trotzdem sind auch im Jugendstrafrecht bei wiederholten schweren Verfehlungen oder schweren Straftaten empfindliche Sanktionen bis hin zu mehrjährigen Freiheitsstrafen möglich. Umso wichtiger ist es, dass Sie bei Vorwürfen gegen Ihren Nachwuchs oder gegen sich selbst auf kompetente Unterstützung durch einen Anwalt für Jugendstrafrecht setzen.
Vertrauen Sie auf die Unterstützung durch einen Anwalt für Jugendstrafrecht
Neben der sicheren Kenntnis der rechtlichen Besonderheiten des Jugendstrafverfahrens bedarf die Verteidigung von Jugendlichen und Heranwachsenden vor allem in menschlicher Hinsicht besonderer Fähigkeiten. Ein guter Jugendstrafverteidiger muss in der Lage sein, seinen jungen Mandanten kommunikativ zu erreichen, ein Vertrauensverhältnis zu ihm aufzubauen und die richtigen Impulse zu vermitteln. Mit meiner Kanzlei, der Strafrechtskanzlei Clausen in Berlin, habe ich bereits in unzähligen Jugendstrafverfahren Verteidigungen übernommen und verfüge über große praktische Erfahrung und hohe fachliche Expertise in der Verteidigung junger Beschuldigter. Mein Anspruch ist es, in jedem Verfahren das bestmögliche Ergebnis für meine Mandantschaft zu erzielen.
